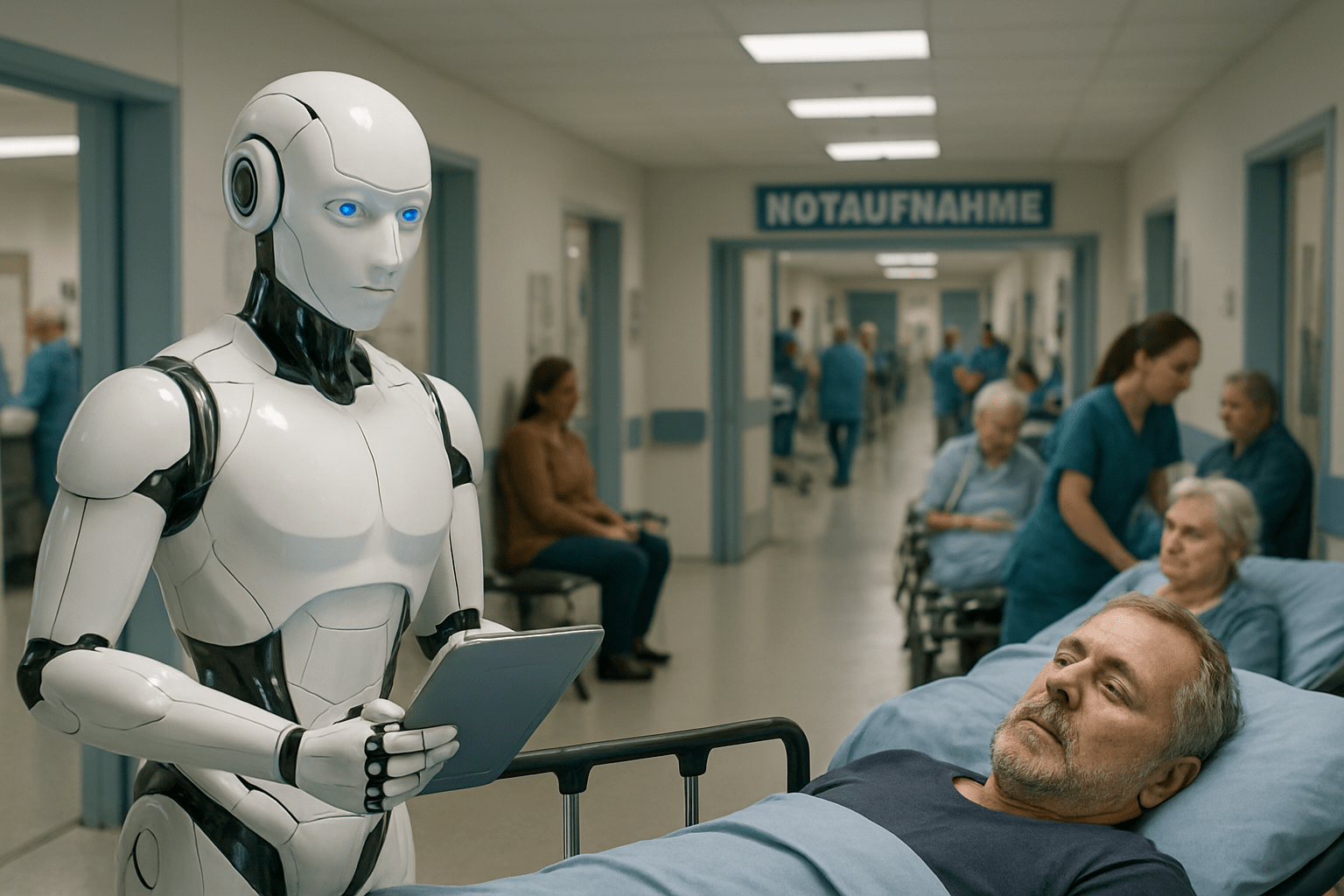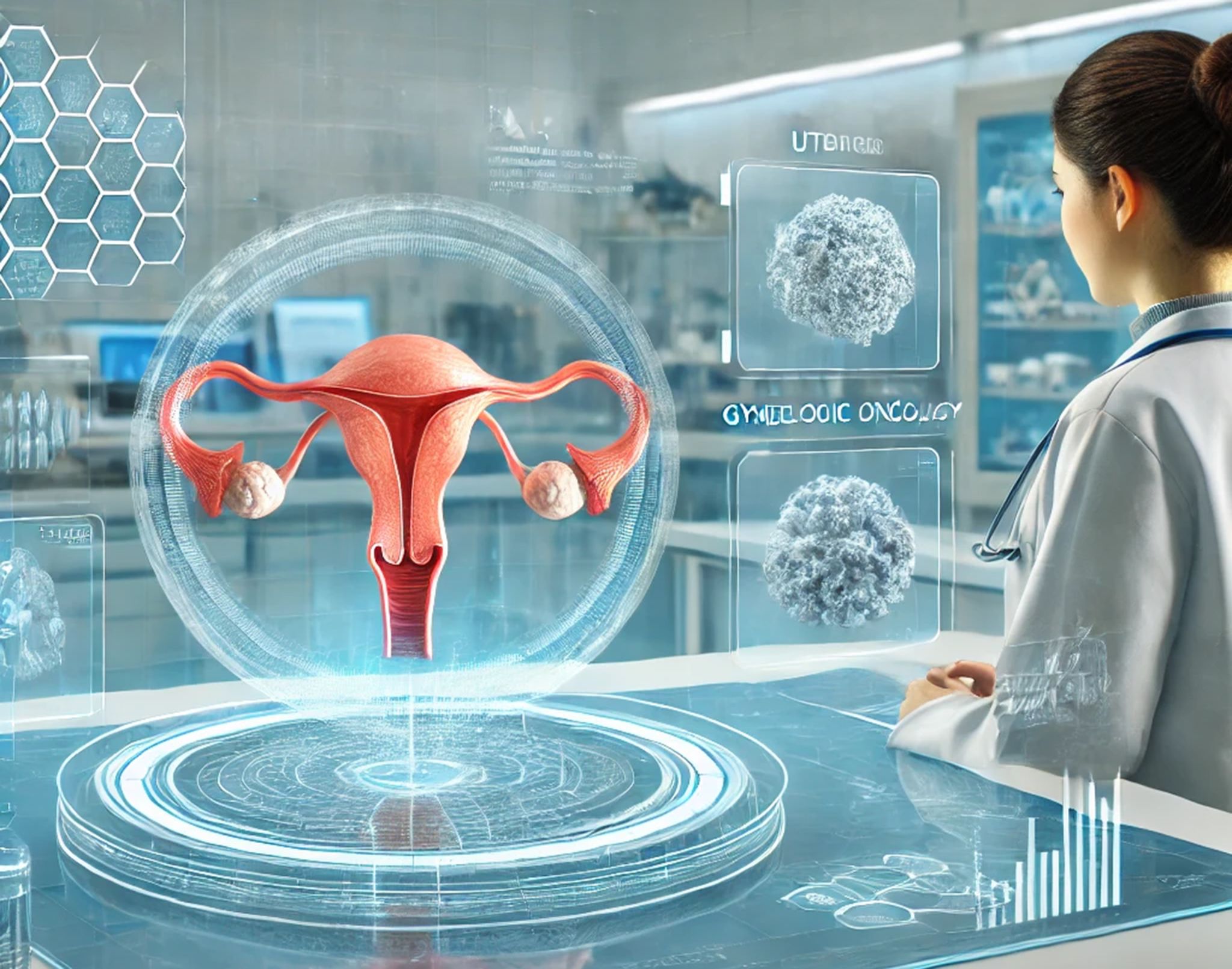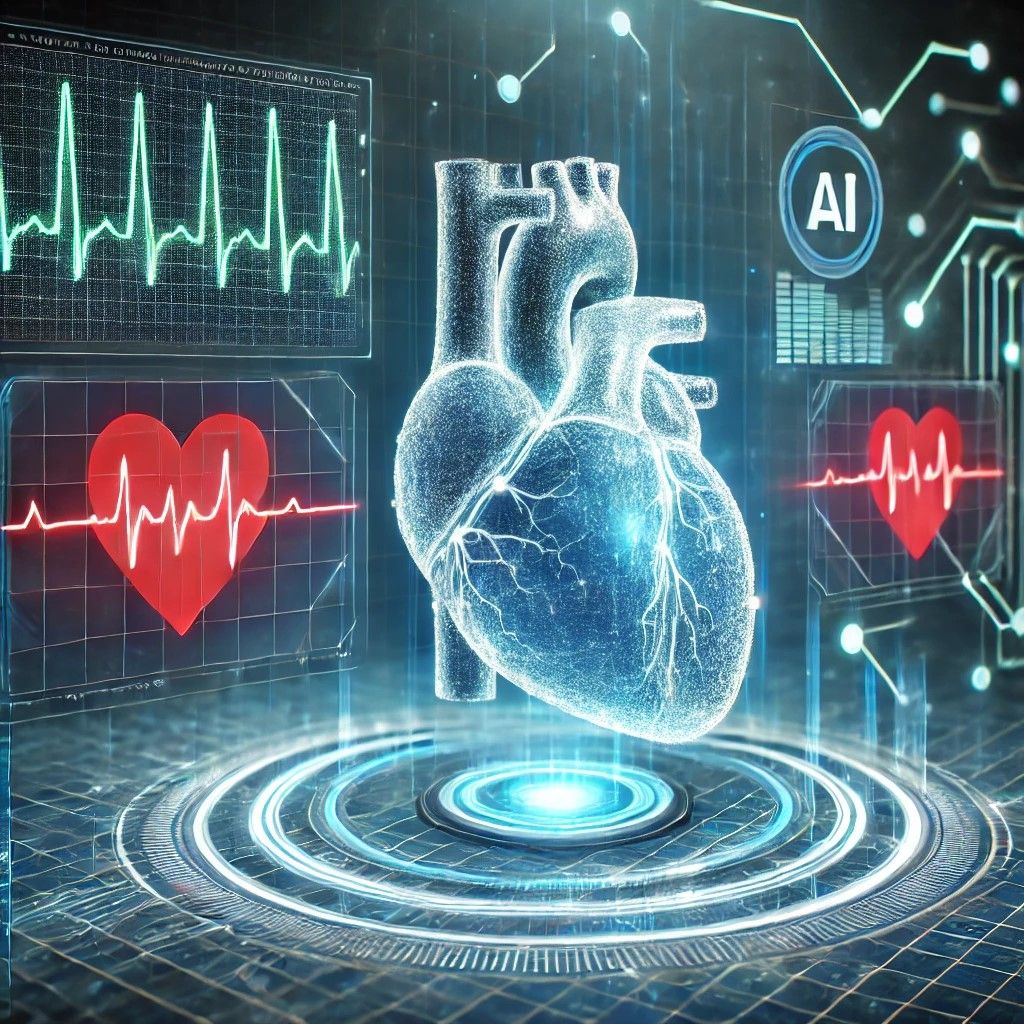Die Onkologie ist aktuell das dynamischste Fachgebiet der Medizin. Nirgendwo werden mehr neue Arzneimittel zugelassen, nirgendwo wächst das Wissen schneller als hier. So beindruckend die Erfolge der Immunonkologie sind, spricht nach wie vor nur ein Teil der Patienten auf die Therapie an und bei vielen Krebsarten liegt der Prozentsatz nur bei 20%. Vier von fünf Patienten profitieren also nicht von einer solchen Therapie.
Doch wie findet man die geeigneten Patienten? Mithilfe vom molekularen Markern. Bei dieser Art der Diagnostik könnten Big Data und Machine Learning eine zunehmend prominente Rolle spielen, denn das Erkennen von definierten Strukturen in Bildern gehört zur Kernkompetenz der Computer. Ein digitales System muss dabei nicht besser sein als ein menschlicher Pathologe oder Radiologe, kann aber 7 Tage in der Woche 24 Stunden Dienst schieben. Und damit helfen, den riesigen Bedarf an molekularer Pathologie zu decken, den die modernen Immuntherapien erfordern.
Für den flächendeckenden automatisierten Einsatz fehlt es aber nicht nur an geeigneten Systemen und menschlichen Operatoren, auch fehlt bei vielen Markern noch ein etablierter Standard. Um zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit zu errechnen, ob ein Patient auf einen modernen Checkpointinhibitor anspricht, kann der Marker PD-L1 in einem histologischen Schnitt des Tumors gemessen werden. Dummerweise gibt es dazu aber unterschiedliche Zählweisen: Während beim Tumor Proportion Score (TPS) der Prozentsatz positiver Tumorzellen ermittelt wird, misst man beim Immune Cell Score (IC) den Anteil des Tumors mit positiven inflammatorischen Zellen. Dabei handelt es sich um einen Flächen-Score, nicht um einen Zell-Score.
Man vergleicht also Äpfel mit Birnen. Das führt zu der Situation, dass die Angaben für die Wirkung der unterschiedlichen Medikamente auch nur mit Vorsicht zu vergleichen sind. So lange diese Frage nicht gelöst ist, bleibt die digitale Pathologie noch ein ganzes Stück weit weg.