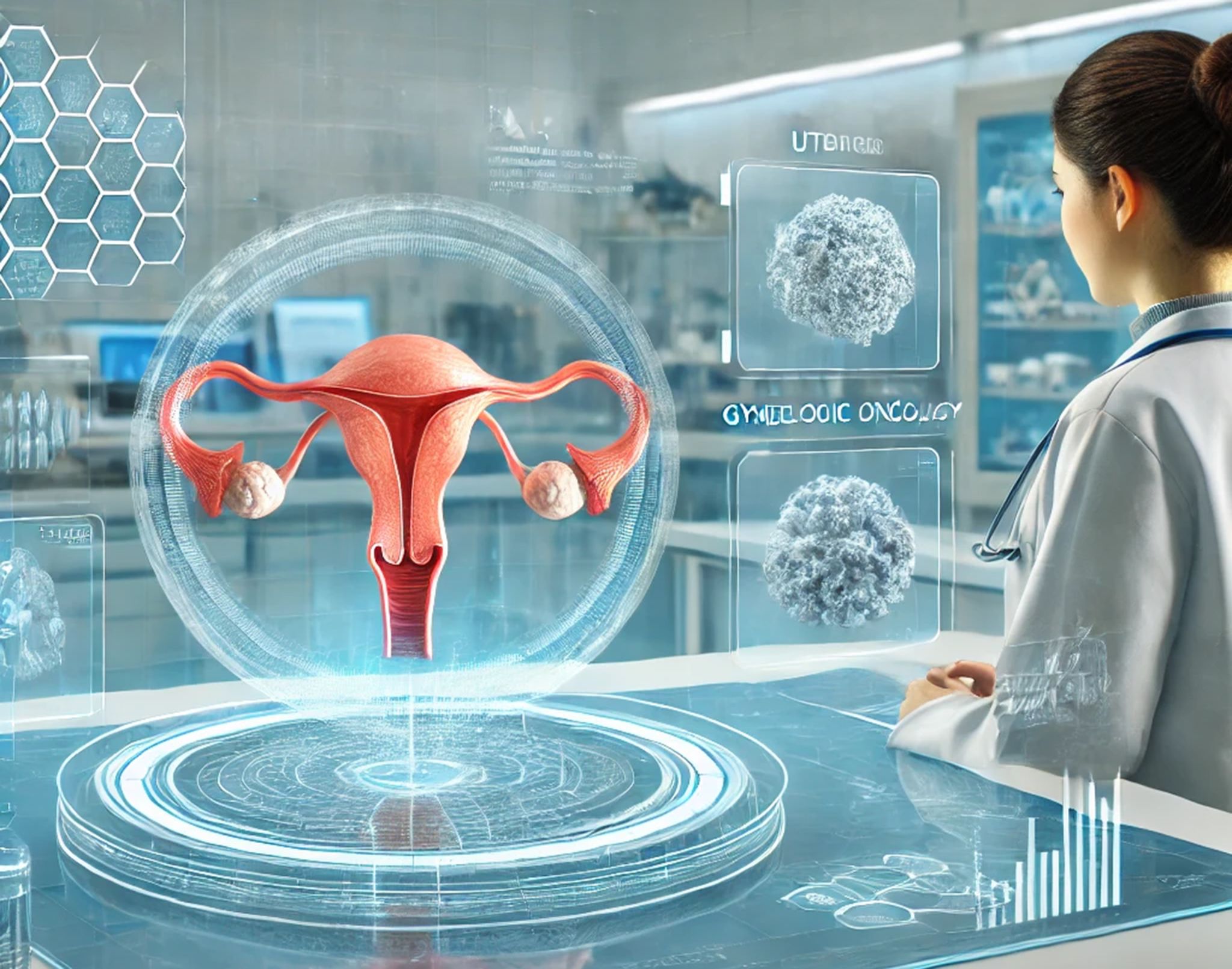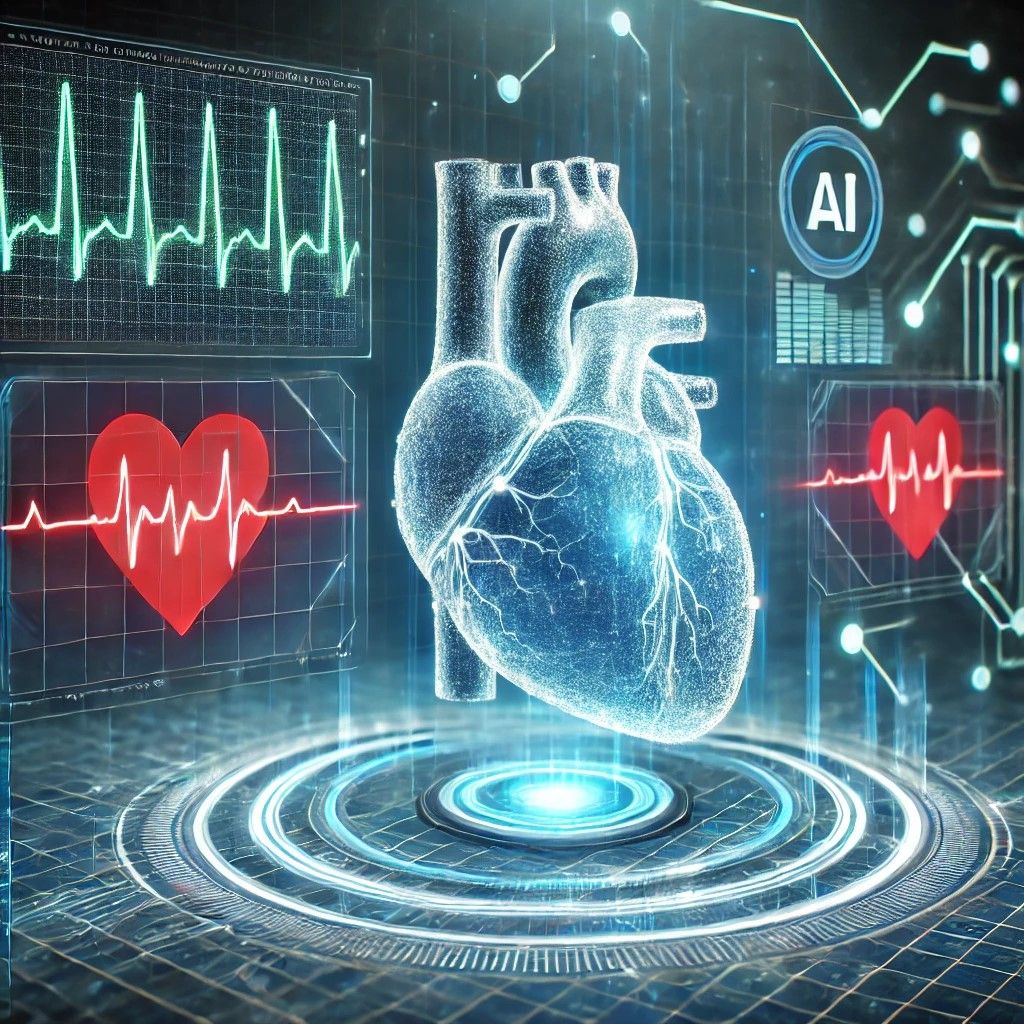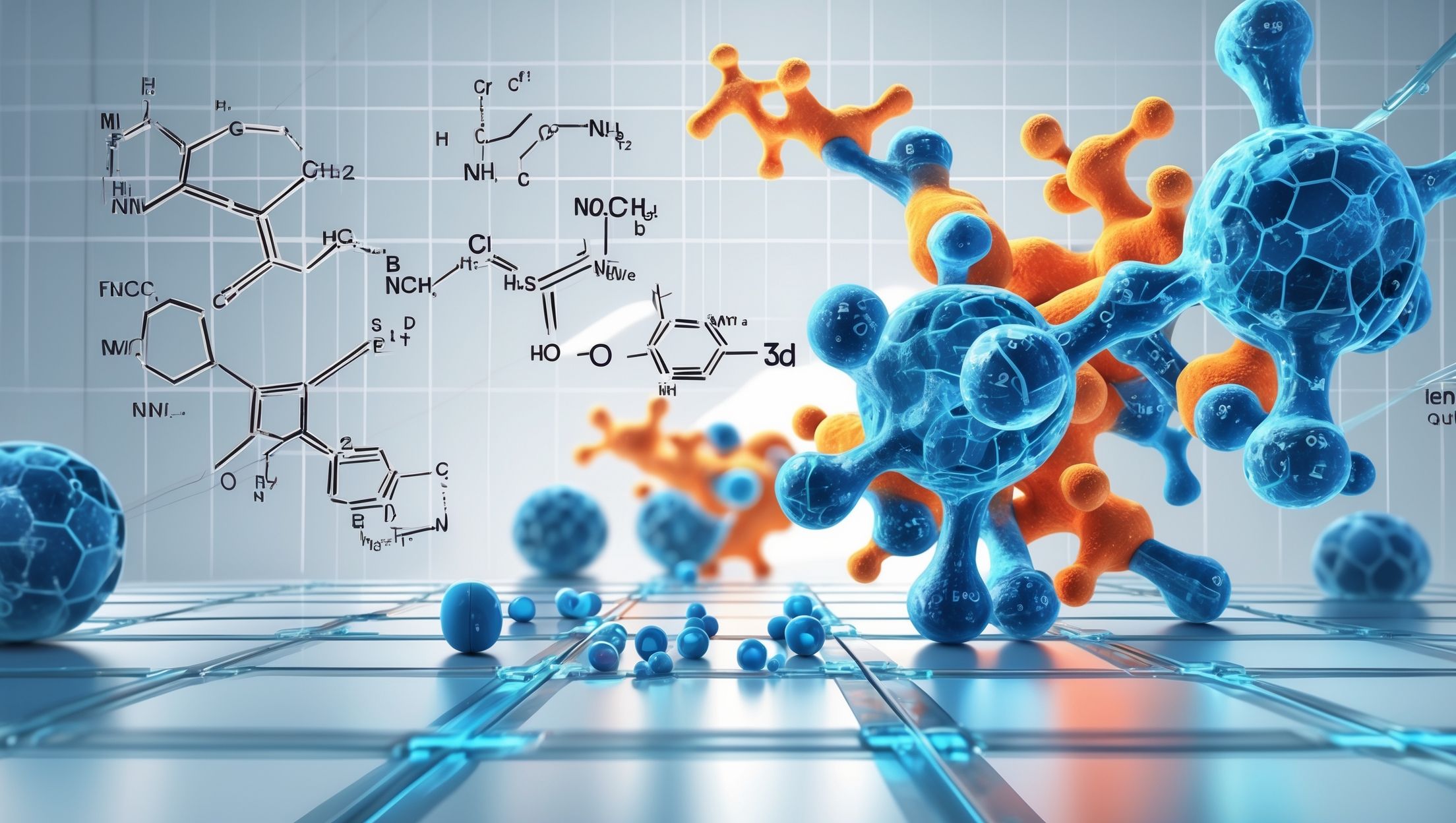Ich will sie, ich will sie nicht, ich will sie, ich will sie nicht … Die Diskussion um die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) ist seit Jahren mehr vom politischen Wollen oder Nichtwollen diktiert, als vom tatsächlichen Nutzen. Der steht nämlich außer Frage. Neben dem Datenschutz ist das Hauptargument der Akten-Skeptiker das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient. Das sehen sie in hohem Maß gefährdet.
Die Zeitschrift Ethik in der Medizin hat diesem Thema jetzt ein aktuelles Review gewidmet und dazu mehr als 50 internationale Studien herangezogen, die sich mit dem Einfluss der ePA auf das Arzt-Patienten-Verhältnis befassen. Ihr Urteil ist eindeutig: „Die von medizinethischer Seite geäußerten Bedenken bezüglich eines Vertrauensverlustes oder einer Störung des Arzt-Patienten-Verhältnisses konnten in den empirischen Studien nicht bestätigt werden.“
Einen besonderen Fokus legten sie dabei auf die persönliche elektronische Patientenakte (pePA), die einrichtungsübergreifend vom Patienten gesteuert wird. Danach werden die Abläufe in der Behandlung für den Patienten durch die pePA transparenter und die Gesamtkommunikation der Leistungserbringer besser, weil der Patient aufgrund seiner persönlichen Erfahrung mit der Krankheit auf besondere therapeutische Aspekte verweisen kann.
Das befürchtete Störpotenzial für das Vertrauensverhältnis war nirgendwo auszumachen, daher folgern die Autoren: „Unter Wahrung des Datenschutzes hat die pePA das Potenzial, durch die Mitbeteiligung des Patienten das Arzt-Patienten-Verhältnis positiv zu beeinflussen.“ Einen praktischen Tipp gibt es gleich noch obendrauf: Wer im Patientengespräch die Akte im Blick hat, sollte darauf achten, dass der Bildschirm nicht zwischen ihm und dem Patienten steht.